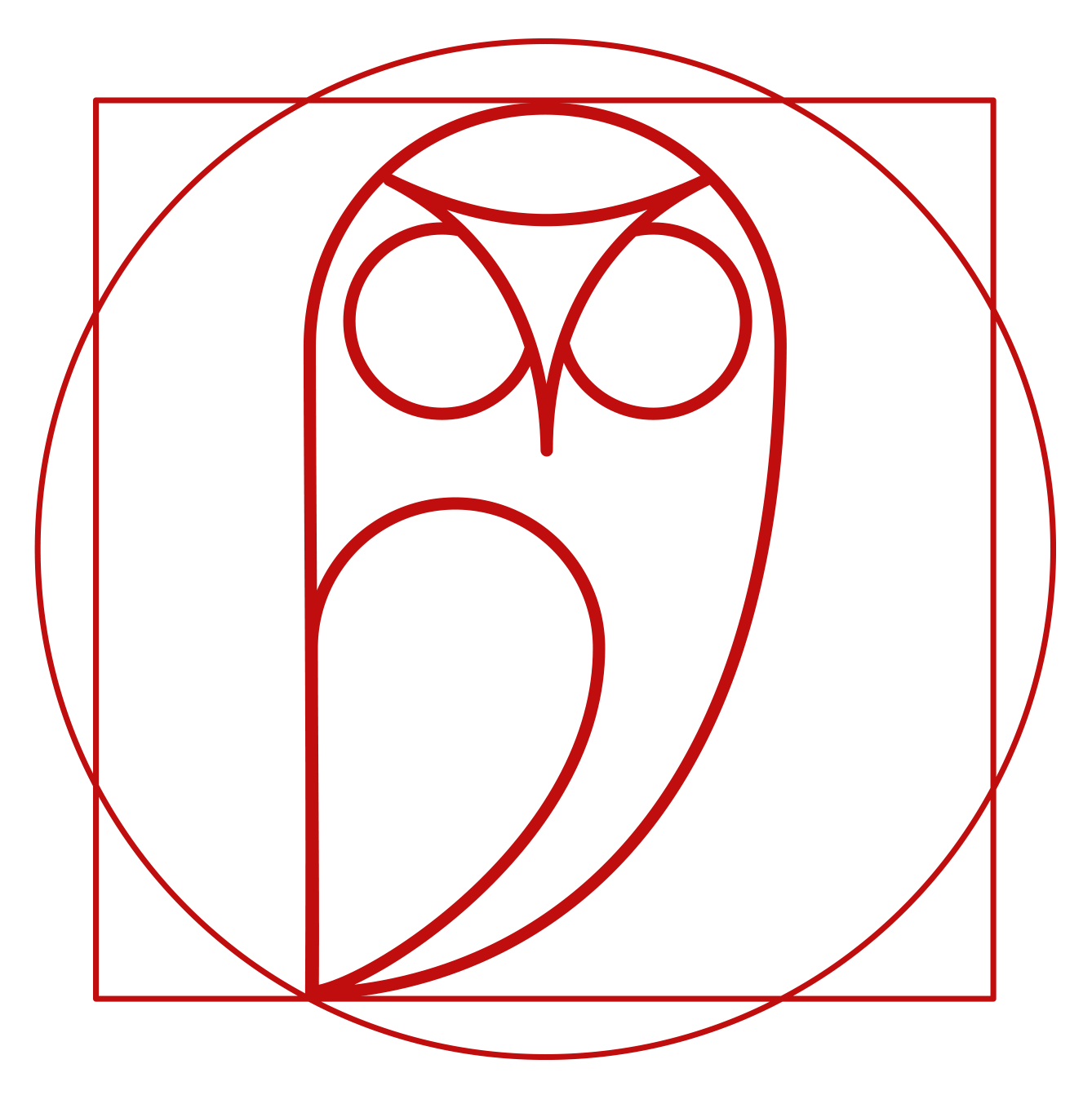Im »Informationszeitalter« laufen wir Gefahr, an Informationen so gefesselt zu werden – »wir informieren uns zu Tode« –, dass sie, statt uns zu bereichern, uns Lebenszeit wegnehmen, wenn wir meinen, alles wissen zu müssen, was uns dargeboten wird.
Es braucht einige Zeit, um sich von solchen Gewohnheiten zu lösen, die zu Zwängen geworden sind, und ferner zu erkennen, dass Informationen per se nicht dasselbe sind wie heilsames Wissen oder gar Weisheit.
Heute suchen viele Menschen wieder dieses verlorene Verweilen, die Zeit der Muße, die zugunsten einer angeblichen »schöpferischen Unruhe« aufgegeben worden ist. Diese endet, wenn sie nicht weiß, was sie tun soll, im Aktionismus. Da das Getane nicht sinnvoll ist und nur dafür sorgt, in Bewegung zu bleiben, ist es lediglich ein Rennen, ein Davonrennen, ein Rasen.
Es sind viel weniger die Sachzwänge als wir selbst, die uns hetzen, die uns zum Fortschritt zwingen. Fortschritt ist ein verkanntes und verräterisches Wort, denn hier wird nicht auf ein Ziel zugeschritten, sondern von etwas – wohl von der Mitte, die der Mensch im Grunde wieder sucht – »fort« geschritten. Die Ambivalenz dieses »Fortschritts« ist uns trotz aller hilfreichen Erfindungen langsam klar geworden. Aber die Ursachen, besser der Verlust jener Mitte, jenes Grundes, von dem wir uns dabei entfernen, sind noch lange nicht erkannt – und auch in der Tat schwer zu erkennen, wenn man sie zu Wort bringen will.
Sie liegen auch tief in der Wahrnehmung des technisch-naturwissenschaftlichen Denkens verborgen, das uns so viel Erfolge auf einer bestimmten Ebene gebracht hat, aber die Welt oft in einer Weise als vergegenständlicht, entseelt und entmenschlicht darstellt, dass sie als leer und öde erscheint – nicht nur gottlos, sondern »tote Materie«, eine Summe von »Stoffen und Kräften«, die wir glauben durch Erkenntnis der Ursachenketten nach Belieben berechnen und manipulieren zu können, sodass sie uns außer Zahlen und Fakten »nichts mehr zu sagen« haben und die Dichter1, die sie einst besangen, vermeintlich im Unwirklichen herumfantasieren, welt- und realitätsfremd sind.
Johann Wolfgang von Goethe scheint unser rasendes Informationszeitalter vorausgeahnt zu haben, als er in seinen „Chinesisch-Deutschen Jahres- und Tageszeiten“ dichtete:
„Mich ängstigt das Verfängliche
Im widrigen Geschwätz,
Wo nichts verharret, alles flieht,
Wo schon verschwunden, was man sieht;
Und mich umfängt das bängliche,
Das graugestrickte Netz.“
Unsere eigene Eingebundenheit in diese Welt dürfen wir nicht nur kognitiv verstehen, sondern wir müssen sie auch seelisch erfahrbar machen. Wir sollten unseren eigenen Erfahrungen trauen dürfen und uns dabei in unserem Inneren berühren lassen können. Auf diese Weise stillen wir auch unsere menschlichen Grundbedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit.
Um dem Geheimnis des Lebens und der Schönheit auf die Spur zu kommen, ist es bei Weitem nicht ausreichend, die Welt ständig weiter ohne »Geistiges Band« in ihre Einzelteile zerlegen zu können. Es gilt, auch unser Denken, Fühlen und Handeln wieder miteinander zu verbinden und in Einklang miteinander zu bringen.
Goethe äußerte sich zum Mysterium des Schönen einmal mit den Worten: »Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.«2
Der Preis für die großartigen Erfolge und all die Macht, die wir heute durch Technik und Naturwissenschaft haben, ist hoch, sehr hoch, jedenfalls solange nicht deren Wesen erkannt wird und damit deren Grenzen gesehen werden, sodass man sie wieder in ein menschlicheres, nicht nur kausales und funktionales Weltverständnis von der »großen Weltmaschine« einbetten, also nicht leugnen oder »abschaffen« kann, was nicht geht – wir brauchen sie –, aber im Hegel’schen Sinne sollten wir sie »aufheben«, das heißt zugleich überwinden und bewahren.