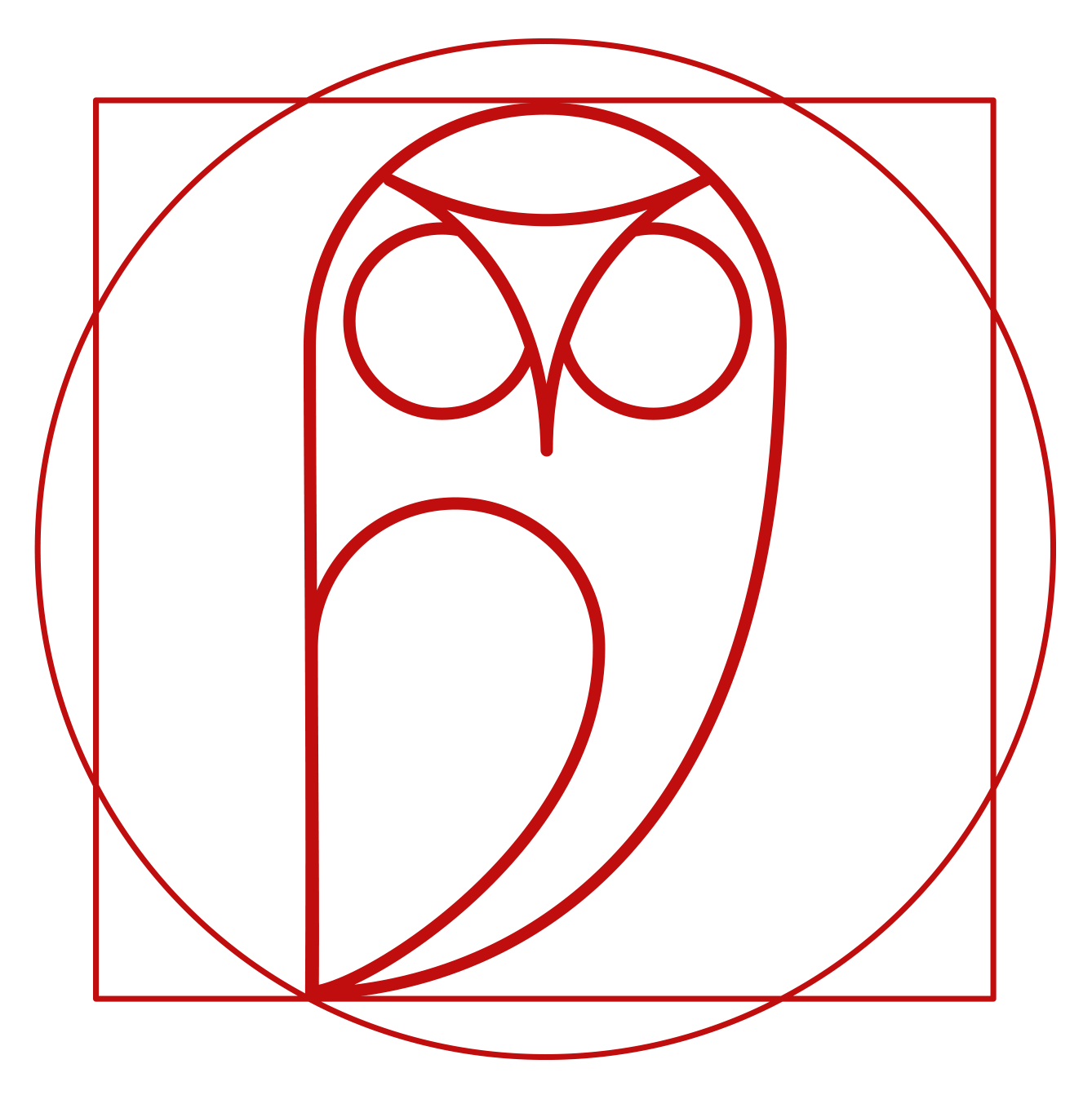KI, Ethik und Frieden in disruptiven Zeiten
Dietrich Werner gilt als Brückenbauer zwischen Kirchen, Kulturen und Entwicklungsarbeit. Als Theologe mit Weitblick steht er für eine Kirche, die sich offen, dialogbereit und solidarisch den Herausforderungen einer globalisierten Welt stellt.
Dietrich Werner ist ein international anerkannter evangelischer Theologe, Ökumeniker und Experte für interkulturelle Theologie und Entwicklungsethik. Er war viele Jahre in leitenden Positionen tätig, unter anderem beim Weltkirchenrat in Genf und beim Hilfswerk „Brot für die Welt“. Als Professor lehrte er an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland.
Dietrich Werner ist außerdem Mitglied der Think Tank-Kommission „Religion und Entwicklung“ beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ehemaliges Mitglied der Kammer für nachhaltige Entwicklung der EKD sowie der Ökumene-Kammer der EKD und ordinierter Pfarrer.

Wir leben in einer neuen, weltpolitisch höchst riskanten und einzigartig disruptiven Ära.
Prof. Dr. Dietrich Werner hat am 19. September 2025 einen Vortrag gehalten und dazu mit Werner H. Heussinger ein Interview geführt.
Werner H. Heussinger sprach mit Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Werner über KI, Ethik und Frieden in Zeiten technologischer Revolution und geopolitischer Polarisierung.
Seit 2024 ist Dietrich Werner Präsident der Globethics Foundation, die sich als Denkfabrik (Think Tank) für ethische Bildung und gute Regierungsführung weltweit einsetzt. Die international arbeitende Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf hat beratenden Status des Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC, einem der sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen.
Globethics Foundation setzt sich weltweit für soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und wertebasierte Entscheidungsprozesse ein. Als Plattform für ethische Reflexion vernetzt sie Akteure aus Wissenschaft, Religion, Politik und Zivilgesellschaft, um globale Herausforderungen aus einer werteorientierten Perspektive zu gestalten.
„Genau in diesem gefährlichen Vakuum sehe ich eine immense, eine historische Verantwortung für die Träger ethischer Wertetraditionen, insbesondere die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Sie müssen aus ihrer Nische heraustreten, wieder sichtbarer und lauter werden und die Gesellschaft an die unverhandelbaren Grundlagen von Humanität, Menschenwürde und globaler Solidarität erinnern.“

Wir leben in einer Zeit, die Sie als eine „weltpolitisch höchst riskante und disruptive Ära“ beschreiben. Sie sprechen von einem „verlorengegangenen Kompass gemeinsamer ethischer Orientierung“. Können Sie das für uns einordnen und die Dringlichkeit verdeutlichen?
Dietrich Werner: Sehr gerne. Die Dringlichkeit ergibt sich aus einer beunruhigenden Gleichzeitigkeit, die wir so noch nicht erlebt haben: Einerseits eine vierte industrielle Revolution, die massiv und mit ungeheurer Geschwindigkeit von Künstlicher Intelligenz angetrieben wird und alle Lebensbereiche durchdringt. Andererseits eine tiefe, fundamentale Erschütterung der internationalen Ordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam aufgebaut haben. Ob wir auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine blicken, der die europäische Friedensordnung zerstört hat, auf den entsetzlichen Konflikt in Gaza und Israel oder auf die globalen Auswirkungen nationalistischer Tendenzen, wie sie in der US-Administration unter dem Motto „America First“ sichtbar wurden – überall sehen wir dasselbe Muster: Das Recht des Stärkeren ersetzt systematisch die Stärke des Rechts.
Multilaterale Abkommen und Institutionen wie das Pariser Klimaabkommen oder die WHO werden geschwächt oder verlassen, die Diplomatie wird durch rohe Wirtschaftsdeals und Erpressung ersetzt. Der gemeinsame ethische Kompass, der auf dem Völkerrecht und den universellen Menschenrechten basierte, scheint nicht nur verloren, er wird aktiv demontiert. Genau in diesem gefährlichen Vakuum sehe ich eine immense, eine historische Verantwortung für die Träger ethischer Wertetraditionen, insbesondere die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Sie müssen aus ihrer Nische heraustreten, wieder sichtbarer und lauter werden und die Gesellschaft an die unverhandelbaren Grundlagen von Humanität, Menschenwürde und globaler Solidarität erinnern.
„Ohne eine explizite, gemeinsam formulierte und getragene Wertebasis bleiben solche Pakte am Ende schwach, sie sind Papiertiger.“

Sie erwähnen in diesem Zusammenhang den „Pakt für die Zukunft“ der Vereinten Nationen von September 2024, ein Dokument voller ambitionierter Ziele, das ja eigentlich diesen Kompass neu justieren sollte. Dennoch üben Sie fundamentale Kritik. Warum ist ein an sich gut gemeintes Papier in Ihren Augen so defizitär?
Dietrich Werner: Der Pakt, maßgeblich von Deutschland und Namibia vorbereitet, ist ohne Frage ein Meisterwerk des Versuchs, den Multilateralismus wiederzubeleben. Er benennt die richtigen, drängenden Themen: nachhaltige Entwicklung, Frieden, technologische Kooperation, die Stärkung globaler Institutionen. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein fatales Manko: Das entscheidende Wort „Ethik“ oder der Begriff „ethische Leitwerte“ taucht auf 32 Seiten kein einziges Mal auf. Das ist nicht nur ein semantisches Versäumnis, es ist ein konzeptionelles Versagen. Das Dokument schreit förmlich nach einer ethischen Grundierung, nach einem Fundament, auf dem die politischen Ziele aufbauen können, aber diese Basis wird nicht benannt. Für mich spiegelt das ein tiefes Strukturproblem der UN wider.
Sie versteht sich primär als eine Organisation von Regierungen und ist in ihrer Arbeitsweise und Sprache oft säkular geprägt. Religiöse und zivilgesellschaftliche Akteure werden zwar manchmal erwähnt, aber oft eher als ein „Spaltfaktor“ für die internationale Gemeinschaft gefürchtet, denn als verlässliche Partner bei der Herstellung einer gemeinsamen Werte-Kohärenz anerkannt. Das ist ein fundamentaler Fehler. Ohne eine explizite, gemeinsam formulierte und getragene Wertebasis bleiben solche Pakte am Ende schwach, sie sind Papiertiger. Sie entfalten keine Bindungskraft und können, wie wir ja kurz nach der Verabschiedung schmerzlich erfahren mussten, von politischen Realitäten einfach überrollt werden.
„Es geht um die Wiederbelebung von Vertrauensbildung und Sicherheits-Partnerschaften jenseits militärischer Logik, wie es die OSZE einst versuchte.“

Sie verwenden, wie auch viele Politiker, den Begriff der „Zeitenwende“. Aber Sie füllen ihn völlig anders. Die eigentliche Zeitenwende, sagen Sie, liegt noch vor uns. Was genau meinen Sie damit und wie unterscheidet sich Ihre Vision von der gängigen politischen Lesart?
Dietrich Werner: Genau, das ist ein entscheidender Punkt. Im öffentlichen und politischen Diskurs wird „Zeitenwende“ fast ausschließlich auf die sicherheitspolitische Reaktion auf den Ukraine-Krieg verengt: auf Aufrüstung, die Stärkung der NATO und die Herstellung militärischer „Kriegsfähigkeit“. Das ist eine verständliche, vielleicht sogar notwendige Reaktion auf eine akute Bedrohung, aber sie greift viel zu kurz und birgt die Gefahr einer neuen Rüstungsspirale. Eine wirkliche Zeitenwende, eine, die diesen Namen verdient, müsste eine Hinwendung zu einer umfassenden und integrativen planetarischen Friedensordnung sein, wie sie etwa in der Agenda 2030 oder in der Idee einer „Weltinnenpolitik“ von Carl Friedrich von Weizsäcker angelegt ist. Sie muss ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und internationalen Frieden als untrennbare Einheit begreifen.
Eine solche Wende kann nicht durch mehr Waffen, sondern nur durch einen tiefgreifenden, transnationalen Ethikdiskurs begründet werden, der die Leitwerte von Humanität, Menschenwürde und Respekt vor regelbasierten Ordnungen wieder ins Zentrum rückt. Es geht um die Wiederbelebung von Vertrauensbildung und Sicherheits-Partnerschaften jenseits militärischer Logik, wie es die OSZE einst versuchte. Diese Wende muss noch stattfinden. Sie ist ein Imperativ für das Überleben der Menschheit, und wir können sie nur gestalten, wenn wir die ethischen Potentiale der Zivilgesellschaft und der Religionen weltweit mobilisieren und ernst nehmen.
„Die KI hat den Krieg nicht menschlicher oder sauberer gemacht, sondern brutaler, schneller und enthemmter.“

Lassen Sie uns das an einem Beispiel konkret machen, das Sie prominent behandeln. Ein zentrales Feld ist der Einsatz von KI im Militärischen. Sie nennen das Beispiel der israelischen Software „Habsura“, zynischerweise auch „Gospel“ genannt, im Gaza-Krieg. Was offenbart dieses Beispiel über die wahre Rolle von KI in modernen Kriegen?
Dietrich Werner: Dieses Beispiel ist erschütternd und entlarvend zugleich, weil es die Propaganda der Tech-Rüstungsindustrie Lügen straft. Das Heilsversprechen militärischer KI lautet ja: mehr Präzision, schnellere Entscheidungen, besserer Schutz von Zivilisten durch klare Unterscheidung von Kombattanten und Nicht-Kombattanten. Die Realität von „Gospel“ und ähnlichen Systemen wie „Lavender“ zeigt das genaue Gegenteil. Die Zahl der von der KI als legitime Angriffsziele identifizierten Punkte explodierte von ehemals etwa 50 pro Jahr, die von Menschen mühsam verifiziert wurden, auf bis zu 250 Angriffszielen pro Tag, die von KI identifizier wurden. Laut Berichten hat die israelische Luftwaffe so bis November 2023 über 22.000 Ziele bombardiert.
Dies, in Kombination mit dem Einsatz unpräziser „dummer Bomben“, führte zu einem massiven und völlig unverhältnismäßigen Anstieg der zivilen Opfer. Die KI hat den Krieg nicht menschlicher oder sauberer gemacht, sondern brutaler, schneller und enthemmter. Die menschliche Letztverantwortung wird zur reinen Illusion, wenn Entscheidungen über Leben und Tod von Tausenden in Sekundenbruchteilen auf Basis von undurchsichtigen Algorithmen getroffen werden, deren Datenbasis niemand mehr vollständig überprüfen kann. Wir sehen hier einen verhängnisvollen und bewusst gegangenen Schritt hin zu einer vollautomatisierten „Kill Chain“, einer Tötungskette, bei der die Maschine das Kommando übernimmt und der Mensch nur noch zum Abnicker wird.
„Die technologische Entwicklung rast voran, aber die ethische und gesellschaftliche Reflexion über die Folgen hinkt meilenweit hinterher.“

Die Entwicklung schreitet noch weiter voran, in eine Richtung, die Sie als „Neurowarfare“ bezeichnen – die direkte neurotechnologische Optimierung von Soldaten. Das klingt nach Science-Fiction, scheint aber Realität zu sein. Welche ethische Grenze wird hier endgültig überschritten?
Dietrich Werner: Hier wird nicht nur eine Grenze überschritten, hier wird die Büchse der Pandora geöffnet, und zwar mit voller Absicht. Das ist keine ferne Zukunftsvision mehr. Seit 2014 gibt es in den USA die „Brain Initiative“, und Forschungsagenturen des Pentagons wie DARPA arbeiten explizit an Brain-Computer-Interfaces (BCI). Das Ziel wird offen formuliert: Soldaten sollen in die Lage versetzt werden, Waffensysteme allein mit ihren Gedanken zu steuern, und zwar – und das ist der entscheidende Punkt – noch vor einer bewussten, reflektierten Willensentscheidung. Es geht um die mögliche Erschaffung von „Supersoldaten“ mit genetisch oder technisch modifizierten Gehirnfunktionen, die keine Furcht, kein Mitleid, keine Emotionen mehr zeigen – und die ohne humane Rücksichtnahme zerstören.
Hier konstatieren wir eine massive und brandgefährliche Ungleichzeitigkeit: Die technologische Entwicklung rast voran, aber die ethische und gesellschaftliche Reflexion über die Folgen hinkt meilenweit hinterher. Wir riskieren, dass wir die gravierenden Schadenswirkungen erst dann erkennen, wenn es zu spät ist und die Technologie unkontrollierbar in der Welt ist – genau wie wir es bei Social Media erlebt haben. Es geht hier um nichts weniger als die Zukunft des Menschen, seine Identität, seinen freien Willen. Deshalb brauchen wir jetzt, und nicht erst in zehn Jahren, eine dringende Debatte über sogenannte „Neurorights“ – also neue, völkerrechtlich verankerte Grundrechte zum Schutz unserer geistigen Privatsphäre, unseres freien Willens und der Integrität unserer Persönlichkeit.
„Der Mensch bleibt auch im digitalen Zeitalter verletzliches Geschöpf, nicht Schöpfer seiner selbst. Die Gottebenbildlichkeit, von der die Bibel spricht, begründet seine unveräußerliche Würde.“

Das führt uns direkt zur anthropologischen Grundfrage, zur Frage nach dem Menschenbild. Der Vatikan hat im bemerkenswerten Dokument „Antiqua et Nova“ Anfang 2025 eine sehr scharfe Trennlinie zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz gezogen. Warum ist diese Unterscheidung so existenziell wichtig, gerade angesichts von Bewegungen wie der „Church of AI“?
Dietrich Werner: Sie ist absolut fundamental und das wichtigste philosophische und theologische Korrektiv zur technologischen Hybris der Tech-Giganten und offen transhumanistischer Bewegungen wie der „Church of AI“. Diese in den USA gegründete Gemeinschaft betreibt eine quasi-religiöse Verehrung der KI und propagiert die Vision einer Verschmelzung von Mensch und Technik, um Einschränkungen, Krankheit, Alter und Tod zu überwinden. Ihre Logik gipfelt in der Erwartung, dass KI bald „allgegenwärtig, allwissend und die mächtigste Wesenheit der Erde“ sein wird. Das ist die Apotheose der Technik. Dagegen setzt das vatikanische Dokument die unaufgebbare christliche Einsicht: Menschliche Intelligenz bleibt immer verkörpert, sie ist „embodied intelligence“.
Sie umfasst eben nicht nur rationale Datenverarbeitung, sondern untrennbar damit verbunden Emotionalität, Empathie, Gewissen, moralisches Urteilsvermögen, Kreativität und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das kann keine KI ersetzen, sie kann es bestenfalls simulieren. Der Mensch bleibt auch im digitalen Zeitalter verletzliches Geschöpf, nicht Schöpfer seiner selbst. Die Gottebenbildlichkeit, von der die Bibel spricht, begründet seine unveräußerliche Würde. Ein rein technizistischer Reduktionismus, der den Menschen zur optimierbaren, fehlerhaften Maschine degradiert, die es zu „verbessern“ gilt, führt in eine technokratische Sackgasse. Aus diesem ganzheitlichen, relationalen und auch leidensfähigen Menschenbild erwachsen die unverzichtbaren ethischen Grenzen für den Einsatz und die Entwicklung von KI.
„Die existenzielle Bedrohung, die von unregulierter KI ausgeht, erfordert gemeinsames Handeln, trotz aller geopolitischen Spannungen.“

Aus all diesen Sorgen leiten Sie eine konkrete politische Forderung ab: eine völkerrechtlich verbindliche Global Convention on AI, Data and Human Rights. Mit der „Munich Convention on AI, Data, and Human Rights“ gibt es einen Entwurf dafür. Wie realistisch ist eine solche globale Regulierung in unserer polarisierten Welt, und was wären die Kernpunkte, die über bisherige Ansätze hinausgehen?
Dietrich Werner: Die Aufgabe ist herkulisch, keine Frage. Aber sie ist alternativlos, wenn wir nicht in eine Dystopie abgleiten wollen. Die existenzielle Bedrohung, die von unregulierter KI ausgeht, erfordert gemeinsames Handeln, trotz aller geopolitischen Spannungen. Die Kernpunkte einer solchen Konvention wären für mich eine Art „10 Gebote für eine vertrauenswürdige und ethische KI“. Dazu gehören die sieben bereits von der EU formulierten technischen Prinzipien wie Transparenz, Robustheit, Datenschutz und menschliche Aufsicht. Diese sind wichtig, aber nicht ausreichend. Ich würde sie dringend um drei materiale, substanzielle und friedensethische Prinzipien ergänzen, die dem Ganzen eine Richtung geben:
Eine KI muss erstens nachweislich der Befähigung zum Frieden dienen, zweitens aktiv die Menschenwürde unterstützen und schützen, und drittens die globale und soziale Gerechtigkeit fördern, anstatt Ungleichheiten zu zementieren. Wir müssen die Logik umkehren. Wir investieren global Milliarden über Milliarden in militärische KI – der Markt soll von heute 28 auf 65 Milliarden Dollar bis 2034 anwachsen –, aber wir investieren fast nichts in die Erforschung und den Einsatz von „AI for Peace“. Dieses dramatische Ungleichgewicht muss durch eine verbindliche Konvention adressiert und verändert werden.en Einsatz und die Entwicklung von KI.
„Die ethische Grundverantwortung liegt bei uns allen, den Menschen. Wir müssen sie jetzt wahrnehmen.“

Herr Professor Werner, vielen Dank für diese tiefgreifenden und zu Recht auch beunruhigenden Einblicke. Wenn Sie all das zusammenfassen: Was ist Ihre zentrale Botschaft an die Politik, an die Wirtschaft, aber auch an jeden Einzelnen von uns, der sich vielleicht ohnmächtig fühlt?
Dietrich Werner: Meine zentrale Botschaft ist eine Mahnung und ein Appell zugleich: Menschen machen KI, aber KI macht keinen neuen Menschen. Die Zukunft dieser transformativen Technologie hängt einzig und allein davon ab, von wem, für was und mit welchen Interessen und welchem Menschenbild sie gestaltet und eingesetzt wird. Wir dürfen die Definition dieser Zukunft nicht den Profitinteressen der Tech-Konzerne, den Strategen des Militärs oder den Visionären des Transhumanismus überlassen. Das wäre eine Kapitulation der Demokratie und der Humanität. Es braucht eine breite, informierte und streitbare gesellschaftliche Debatte und einen starken, robusten ethischen Rahmen, der im Völkerrecht verbindlich verankert ist.
Ohnmacht ist keine Option. Jeder von uns ist gefragt, sich Digitalkompetenz anzueignen, kritisch zu hinterfragen, wem die Technologie dient, und sich in seinem Umfeld – ob im Beruf, in der Gemeinde, in der Politik – für eine KI einzusetzen, die als Werkzeug der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens geplant, konstruiert und eingesetzt wird – und nicht als Instrument der Überwachung, der Unterdrückung, der Ausgrenzung oder der tötenden Gewalt. Die ethische Grundverantwortung liegt bei uns allen, den Menschen. Wir müssen sie jetzt wahrnehmen.